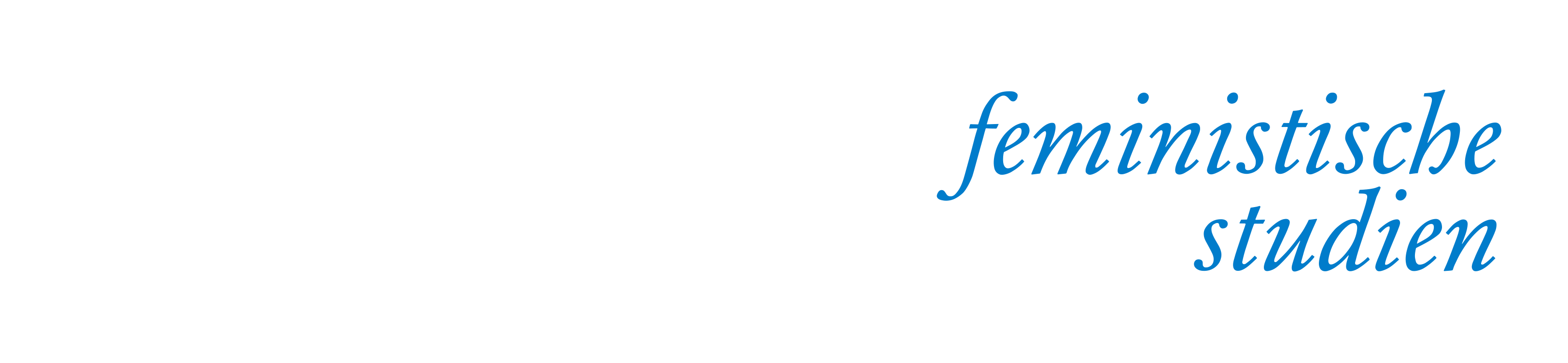Aktuell
Feministisches Erinnern II: Kontroversen, Allianzen, Zukünfte | Heft 2_2023
Einleitung
Von Sabine_ Hark und Tanja Thomas
„Vergessen … ist das denn ein Trost?!“, bezweifelt Tony Buddenbrock den Rat ihres Bruders Thomas in der berühmten Kutschenszene in Thomas Manns Roman Die Buddenbrooks. Sie müsse die zurückliegenden Wochen an der See und ihre – Klassen- und Statusgrenzen überschreitende – Liebe zu Morten vergessen, rät der Bruder. Die Zeit würde schnell alle Wunden heilen und ihr so die ihr unausweichlich zugedachte Zukunft als großbürgerliche Ehefrau zurückgeben, sucht er die aufgewühlte Schwester zu beruhigen. Doch Tony will nicht akzeptieren, wovon Thomas sich auch für sich selbst Trost verspricht: dass Heilung im Vergessen liegt. Tony will nicht vergessen, sie will sich erinnern – und wird, dies nur am Rande, genau aus dieser Erinnerung die Kraft für ihr zukünftiges, an Kümmernissen nicht eben armes Leben schöpfen.
Wir wollen das Buddenbrooksche Gleichnis hier nicht über Gebühr strapazieren, schließlich handelt es sich bei den Buddenbrooks bekanntermaßen um einen Roman, Tony und Thomas sind also fiktionale Figuren. Doch so wie die Geschwister Buddenbrook um eine Antwort auf die Frage ringen, ob Trost eher im Vergessen oder in der Erinnerung zu finden sei, geht es auch in dieser Ausgabe der feministischen studien – der zweiten Nummer, die wir im 41. Jahrgang der Zeitschrift unter der Überschrift „Kontroversen, Allianzen, Zukünfte“ dem Thema Erinnerung und Erinnerungspolitik widmen – um den Widerstreit zwischen Erinnern und Vergessen. Dabei ist es uns, anders als in der Mannschen Kutschenszene, nicht um die – ohnehin nie nur – privaten, intimen und subjektiven Aspekte von Erinnerung zu tun. Nicht das private Glück von Tony und Thomas interessiert uns. Im Fokus stehen vielmehr gesellschaftliche, politische und kulturelle Verhandlungen und Kontroversen um Erinnern und Vergessen – und damit Fragen danach, wie Erzählungen von Vergangenheit mit Perspektivierungen in der Gegenwart und Entwürfen von Zukunft verbunden sind. Uns interessiert, mit anderen Worten, die Rolle von Erinnerung für das, was wir das Glück einer Gesellschaft nennen wollen.Dieses Glück, so meinen wir, ist eng verknüpft mit der Fähigkeit einer Gesellschaft, Erinnerungen an Erfahrungen der Verschiedenen zu hören, zu trauern und neu zu imaginieren; mit ihrem Vermögen also, sich ihren individuell und kollektiv erfahrenen Traumata zu stellen, Verluste zu vergegenwärtigen und angemessene Formen von Rechenschaft, Reparatur und Restitution zu finden. Wie schon in den Beiträgen zum ersten Heft in diesem Jahrgang nehmen auch die Beiträger*innen zu dieser Ausgabe zur Bearbeitung dieser Fragen gegenwärtige Praktiken und Politiken der Erinnerung aus feministischer Perspektive in den Blick, untersuchen diese in ihrer sozialen, politischen und historischen Situiertheit und analysieren exemplarisch, welche Formen der Erinnerung gefunden und welche sozialen Gruppen, Themen und Erfahrungen erinnerungspolitisch bedacht und gewürdigt oder aber ins Abseits gestellt und verworfen werden.
In allen Beiträgen geht es mithin um die zentralen erinnerungspolitischen W-Fragen: An was und an wen wird erinnert, was und wer wird vergessen? Wer erinnert an wen und warum? Wieso wird erinnert oder vergessen? Wie wird erinnert? Dabei loten die Beiträger*innen das Spannungsverhältnis zwischen Erinnern und Vergessen in sehr unterschiedlichen Themenfeldern aus, etwa in der filmischen Erinnerung an die Gewaltgeschichte in deutschen NS-Konzentrationslagern oder in den Erinnerungspraktiken an migrantischen Aktivismus und Feminismus in der Bundesrepublik, im Kontext der Digitalisierung und Plattformisierung von Erinnerung oder in zeitgenössischen Selbstinszenierungs- und Resouveränisierungspraktiken männlicher Intellektueller, Politiker und Schriftsteller. Sie untersuchen, welche Geschichten erzählt werden, wie diese Geschichten nicht nur das konstituieren, was war – Vergangenheit –, sondern auch, welche Schneisen sie bahnen für das, was gewesen sein wird – Zukunft. Sie fragen also danach, wie Erinnerung Gegenwart schafft: indem sie Zugehörigkeit reguliert und indem sie organisiert, wie und als wer wir einander begegnen und zusammenleben (können). Erinnerung sei ein „starkes Projekt der Gegenwart“, heißt es im Gespräch zwischen Hannah Peaceman, Jalda Rebling und Leah Wohl von Haselberg, immer auch von je aktuellen Interessen bestimmt. Sie ist immer „ein Spiegel der jeweiligen Zeit“ und macht zugleich „Angebote für die Zukunft“, argumentiert auch Katja Baumgärtner mit Blick auf die filmischen Verarbeitungen der Geschichte des KZ Ravensbrück. Die Texte fragen entsprechend, wer ihre und seine Geschichte zu Gehör bringen kann und wessen Geschichten zählen und Beachtung finden. Sie untersuchen, mit „welchen Ideen wir andere Ideen denken“, eine Formulierung der Kulturanthropologin Marilyn Strathern (1992, 10), worauf wir also Bezug nehmen, welche Anleihen wir machen und woran wir uns anlehnen, um den Titel der diesjährigen Ausstellung der Dresdner Künstlerin Friederike Altmann in der Brandenburgischen Mahn- und Gedenkstätte des Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück aufzugreifen, und die wir in Bilder und Zeichen vorstellen.
Die Autor*innen der Aufsätze und Berichte, die Teilnehmenden an den drei spannenden Gesprächen – zur Geschichte des migrantischem Feminismus, zu Erinnerungspraktiken an jüdisches Leben und jüdische Kämpfe im post-nationalsozialistischen Deutschland sowie zum Projekt der Kollektiven Erinnerungsarbeit von Frigga Haug –, genauso wie Friederike Altmann in ihrer künstlerischen Erforschung der Geschichte des KZ Ravensbrück und des Lebens der dort inhaftierten, drangsalierten und ermordeten Frauen befragen auch die ästhetischen Formen von Erinnerung und die Möglichkeit von Zeug*innenschaft. Das ist die vielleicht schwierigste erinnerungspolitische Frage. Wem ist es überhaupt möglich, die eigene Geschichte zu erzählen? Wer kann Zeugnis ablegen? Wessen Zeugnis zählt? Dabei ist genau das für das Glück der Gesellschaft unabdingbar: dass wir aus so vielen Perspektiven wie möglich erinnern, berichten und erzählen. Dass wir unsere Geschichten teilen und an den Geschichten anderer teilhaben (können). Dass es möglich ist, in „Gegengeschichten eher vom Überleben als von Abweichung“ zu sprechen, „eher von Gemeinschaft als von Isolation“, wie es Tanja Thomas und Brigitte Hipfl in ihrem Beitrag formulieren. Dass es uns möglich ist, unter allen Umständen unsere Geschichte zu erzählen, wie James Baldwin den – ethischen und politischen – Auftrag der Schriftsteller*innen beschrieben hat. Erzählen, den „Felsen entziffern und beschreiben“, erklärt Baldwin in Von einem Sohn dieses Landes(2022), müssen wir. Und zwar nicht nur, weil etwas, das geschehen ist, und nicht erzählt wird, aufhört zu existieren und verschwindet, wie die Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk in ihrer Stockholmer Nobel-Preisrede Der zärtliche Erzähler (2020) erklärt, sondern weil es auch von Belang ist, in welchen Begriffen und Sinnhorizonten überhaupt erzählt werden kann. Denn erzählt werden wir, ob wir es wollen oder nicht, ob wir die Geschichten mögen oder nicht, ob wir Zugriff auf die Begriffe haben, in denen wir erzählt werden und uns erzählen können oder nicht. Diese Erzählungen verorten uns, sie beschreiben unser So-Sein, beschreiben, wer wir für andere sind und als was wir für sie gelten; sie definieren den Abstand, den wir zum Menschlichen und zur Macht einnehmen (können).
Hinsehen und berichten und dem „begegnen, was Wirklichkeit war“, forderte auch Hannah Arendt von den Deutschen in ihrer Lessing-Preisrede 1959 in Hamburg. Bislang seien sie diese Aufgabe schuldig geblieben, schrieb sie ihnen – uns – damals ins Stammbuch. Ist es inzwischen anders? Wirklich leben heiße, die „Gegenwart zu realisieren“, hatte Arendt wenige Jahre zuvor in ihrem Denktagebuch notiert. Das allgegenwärtige Beschweigen der Shoah im (westlichen) Nachkriegsdeutschland und der Wille, von der eigenen Schuld und Verantwortung nichts wissen zu wollen, hatte sie zutiefst verstört. Von einer Lebenslüge und von der Dummheit würden sie leben, statt sich der Wirklichkeit zu stellen, die gewesen sei, schreibt sie an den in New York zurückgebliebenen Heinrich Blücher. Sich dieser Wirklichkeit zu stellen, dazu gehörte für Arendt unweigerlich das Nie-Vergessen. Und zwar nicht als sentimentales Erinnerungstheater und in der Form der ritualisierten Beschwörung eines phantasmatischen „Nie wieder“, sondern in der Form wahrer Zeugenschaft: die strenge, kritisch auch gegen sich selbst gerichtete Untersuchung dessen, was war, einerseits, sowie die unablässige Suche nach ethisch, ästhetisch und politisch angemessenen Formen des „Wahrsprechens“ (Foucault 2010) andererseits.[1]
Dass wir erinnern, woran und wie wir erinnern, sind also Fragen von Gewicht. Das ist der unmissverständliche Tenor aller Beiträge in diesem 41. Jahrgang der feministischen studien. Was wir aus vermeintlich schlicht gegebenen Fakten machen, die Art der Fragen, die wir an die Fakten richten, die Algorithmen, Raster und Klassifikationen, die wir an Welt anlegen, die Deutungen, die wir ihr auferlegen, die Formate und Technologien, die wir auf sie anwenden, sie gestalten die Welt, in der wir leben; sie entscheiden darüber, wen wir für erinnerungswürdig halten, wen wir leben und atmen lassen. Sie entscheiden mit darüber, was uns angeht, wovon wir uns bewegen lassen und worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Sie lenken, was und wen wir wahrnehmen, um wen und worum wir uns sorgen, wem wir uns mit Empathie zuwenden und gegen wen wir unsere Körper richten. Sie regieren, kurzum, die Art und Weise, wie – und damit für wen – wir Gesellschaft einrichten. Sie sind das Salz der Geschichte, die Essenz des Glücks einer Gesellschaft.
In feministischen Erinnerungspraktiken und -politiken ebenso wie in feministischer Erinnerungsforschung, auch das machen die Beiträge in diesem Heft deutlich, geht es daher um mehr und anderes als um pflichtschuldig niedergelegte Kränze und ritualisiertes Gedenken an ausgewählten Tagen in einem Jahr. Es geht um anderes, weil nicht Nostalgie das Programm ist, weil das erinnerungspolitische Ziel nicht vom Wunsch dominiert ist, zu erinnern, um uns moralisch zu erhöhen oder weil wir uns an womöglich heroisch verklärten früheren Momenten aufrichten möchten. Und es geht um mehr, weil feministisches Erinnern nicht nur der Versuch ist, die mannigfaltige patriarchale Gewaltgeschichte genauso wie die feministischen Kämpfe gegen diese Gewalt dem Vergessen zu entreißen und die Verwobenheit von Macht, Hegemonie, Erinnern und Geschlecht sichtbar zu machen.[2] Es geht auch um das Begehren nach einem anderen Erbe und einer anderen Zukunft. Um das Begehren nach einer Vergangenheit mit der und nach einer Gegenwart in der ausnahmslos alle gut leben können. Um das Begehren nach einer Zukunft der Gleichheit. Feministische Erinnerungspraktiken, feministische Erinnerungspolitik und feministische Erinnerungsforschung sind daher alles andere als merely cultural (Butler 1997): ein möglicherweise verzichtbares add-on zu den hard facts of life. Im Gegenteil: Feministische Erinnerungspraktiken und das wissenschaftliche Nachdenken und Forschen über Erinnerung sind Teil des politischen Projekts der emanzipatorischen Veränderung und der Aufhebung gewaltvoller Verhältnisse in Gegenwart und Zukunft.
Mit einem Beitrag zum gegenwarts- und zukunftsgerichteten feministischen erinnerungspolitischen Potential eröffnen wir entsprechend die Auseinandersetzung um Erinnern und Vergessen im Hauptteil des Heftes. Tanja Thomas und Brigitte Hipfl fragen in ihrem Aufsatz „Feministisches Erinnern – Erinnern an Feminismus. Digitale (Re)Artikulationen potenzialisieren“ genau nach diesem Potential; sie erkennen es insbesondere in der affektiven Dissonanz zwischen Ontologie (den tatsächlichen Bedingungen des Lebens) und Epistemologie (den Vorstellungen vom eigenen Leben). In der Diskussion wichtiger Studien zu feministischem Erinnern und zu Praktiken des Erinnerns an Feminismus loten Thomas und Hipfl aus, wie die feministische Einsicht in die produktive Kraft, die spekulierenden, imaginierenden und affektiven Praktiken und Prozessen innewohnt, erinnerungspolitisch genutzt wird und genutzt werden kann. Ihr Nachdenken über zukünftige Erinnerungspolitiken und -praktiken verbinden sie mit der Beobachtung, dass Digitalisierung auch feministische Erinnerungs- und Archivpraktiken bereits maßgeblich verändert hat und noch weiter verändern wird. Dies sind Herausforderungen, die mit der Einbindung von Erinnerung in Plattformökonomien sowie mit Datafizierung und Algorithmisierung verbunden sind. Die Autorinnen skizzieren diese Herausforderungen und arbeiten am Beispiel digitaler Erinnerungsprojekte erinnerungspolitische Potenziale heraus. Der Text schließt mit einem Plädoyer für ein ‚potenzialisiertes‘ Erinnern und Archivieren für eine queer_feministische Zukunft.
Katja Baumgärtner untersucht in ihrem Aufsatz „Gender, Imagination und Erinnern in Filmen über das Konzentrationslager Ravensbrück: ein Einblick“ Spielfilme, Dokumentar- und Essayfilme, Nachrichtenfeatures und Oral-History-Filme über Ravensbrück, das größte nationalsozialistische Konzentrationslager für Frauen* auf dem damaligen Gebiet des Deutschen Reiches. Baumgärtner macht anschaulich, wie hier ein über die Jahrzehnte immer weiter angereichertes und sich veränderndes „Ravensbrück-Gedächtnis“ entstanden ist, das unterschiedliche Imaginationen entwirft. Mit der Kulturwissenschaftlerin Astrid Erll versteht Baumgärtner Filme dabei als „diskursive Gedächtnisprodukte eines Kollektivs“, die vielfache Sinnkonstruktionen und Ideen wiedergeben, zugleich aber auch ein je spezifisches Gruppennarrativ priorisieren und damit sozio-politischen Konjunkturen unterliegen. Filme haben mit ihrer je eigenen Bildsprache zudem Zeugnischarakter. Sie tragen nicht nur zur Bewusstwerdung historischer Ereignisse in der Gegenwart bei, sondern attestieren dem Publikum auch eine aktivierende und aneignende Rolle.
Um das KZ Ravensbrück geht es auch im dritten Beitrag. Aus einer intersektionalen Perspektive untersucht Ina Glareminin ihrem Beitrag „‘Mindere Vergangenheit‘? Die Debatte um die Gedenkkugel für lesbische Frauen in der Gedenkstätte Ravensbrück“ die historischen, politischen und sozialen Bedingungen, die den jahrzehntelangen Streit über die NS-Verfolgungsgeschichte lesbisch lebender Frauen prägten. Anstoß für die Debatte war der Versuch, ein Gedenkzeichen für die lesbischen Häftlinge im NS-Konzentrationslager Ravensbrück zu errichten. Deutlich wurden in diesem Streit die Bruchlinien zwischen lesbisch-feministischen Aktivistinnen einerseits und (primär cis-männlichen) Historikern und schwulen Aktivisten, allesamt Vertreter der offiziellen Gedenkkultur, die sich für ein Gedenken an Männer, die im NS als Homosexuelle verfolgt worden waren, eingesetzt hatten und die Verfolgung lesbischer Frauen durch das NS-Regime leugneten, andererseits. Der Beitrag zeigt, dass die mangelnde Sichtbarkeit von Lesben in der heutigen Gedenkkultur sowohl in ihrer historischen Unsichtbarkeit als auch in aktuellen patriarchalen, androzentrischen Strukturen begründet ist. Eindrücklich verdeutlicht auch dieser Beitrag, wie sehr Erinnerung von je gegenwärtigen Imperativen und Interessen bestimmt ist.
Wie gegenwärtig Verdrängung und Verleugnung der Erinnerung an feministisches Wissen sind, zeigt schließlich Brigitte Bargetz in ihrem Beitrag „Das Persönliche = politisch = männlich? Ambivalente Ökonomien der Aufmerksamkeit“. Bargetz erinnert an den feministischen Slogan ‚Das Persönliche ist politisch!‘, der das Persönliche als Instanz patriarchaler Gewaltverhältnisse thematisierte und die entpolitisierende Privatisierung des Persönlichen kritisierte. Zugleich zeigt sie auf eindrückliche Weise, dass und wie die Bedeutung dieses Slogans in gegenwärtigen Diskursen verschoben wird und wie diese Diskursverschiebungen Einblicke in eine Arena von Kämpfen um Männlichkeiten eröffnen. Der Beitrag zeichnet diese Entwicklung in drei verschiedenen Bereichen nach, nämlich in der Literatur, der Politik und der akademischen Wissensproduktion. Anhand von drei öffentlichen Figuren – Karl Ove Knausgård, Björn Höcke und Brian Massumi – zeigt Bargetz, dass auf unterschiedliche Weise in allen drei Bereichen eine maskulinistische Politisierung des Persönlichen zu beobachten ist, die als symptomatisch für eine zeitgenössische hegemoniale Remaskulinisierung und eine paradoxe Rekonfiguration des Androzentrismus verstanden werden kann.
Fast ‚vergessene‘ Geschichte(n) ist Thema des ersten Beitrags in unserer diesmal dreifach besetzten Rubrik Im Gespräch. Die immer wieder gewaltvolle und gewaltvoll marginalisierte Geschichte der migrantischen feministischen Bewegung in Deutschland sowie das aktive Verschweigen der politischen und intellektuellen Arbeit und der Kämpfe migrantischer Feminist*innen sind Gegenstand des Austauschs zwischen Behshid Najafi, Ayşe Tekin, Encarnación Gutiérrez Rodríguezund Pinar Tuzcu, moderiert von Onur Suzan Nobrega und Dschihan Zamani. Das Gespräch verdeutlicht die Notwendigkeit und artikuliert zugleich die Forderung, kollektiv und generationenübergreifend Erinnerungspolitiken zu entwickeln, die Erinnerungsräume und -archive für Migrant*innen als intellektuelle politische Subjekte von Wissensproduktion und des Wandels für demokratische Veränderungen schaffen – für eine solidarische Zukunft aller.
Im zweiten Beitrag in dieser Rubrik sprechen Jalda Rebling und Lea Wohl von Haselberg mit Hannah Peaceman über die Bedeutung von Erinnerungspraktiken und Kämpfe für jüdische Gegenwarten in Deutschland. In einem Mehrgenerationengespräch und vor dem Hintergrund unterschiedlicher Sozialisation in der BRD und DDR entfalten sie auf anschauliche Weise religiöse und säkulare feministische Perspektiven auf unterschiedliche Facetten von Vergessen und Verdrängen in der deutschen Dominanzgesellschaft, etwa Unsichtbarmachung, Ignoranz und Aphasie (Ann Laura Stoler). Das Gespräch adressiert somit die gleichzeitige An- und Abwesenheit einer gestörten Erinnerung, Leerstellen in jüdischen Diskursen und Institutionen, aber auch Bedingungen von Sichtbar- und Erzählbarkeit und damit Möglichkeiten kraftvoller wie kreativer Interventionen in und durch Erinnerungspraktiken.
Ein Arbeiten mit den eigenen Erinnerungen als ein Weg, die eigene Handlungsfähigkeit zu vergrößern, motivierte Frigga Haug (1990), die feministische Methode der Kollektiven Erinnerungsarbeit zu entwickeln. Über ihre Mitwirkung an diesem Projekt und ihre Erfahrungen mit dieser Methode berichtet Jutta Meyer-Siebert im Gespräch mit Regine Othmer. Anschaulich berichtet Jutta Meyer-Siebert davon, wie Erinnerungsarbeit eine feministische Lernkultur im Kollektiv stärken kann und in der Erinnerungsarbeit nicht nur Konstruktionen aus den Erinnerungsszenarien rekonstruiert, sondern Wege eröffnet werden, um vergessene Intentionen aufzugreifen, andere Wege einzuschlagen, Leerstellen auszufüllen und auf diese Weise eine andere Vergangenheit zu kreieren, die Wege zu einer alternativen Gegenwart und Zukunft bahnen.
In Bilder und Zeichen stellen wir die Arbeit der Dresdner Künstlerin Friederike Altmann vor. Seit 2015 erkundet Altmann jährlich in mehrwöchigen Aufenthalten beobachtend, recherchierend, zeichnend, lesend, collagierend, das Gelände der heutigen Gedenkstätte Ravensbrück und sucht Antworten auf die oft gestellte Frage, wie die im KZ Ravensbrück inhaftierten Frauen überlebten – und sehr sehr viele überlebten nicht. Im Begleittext zur Ausstellung schreibt die Kuratorin Susanne Altmann – die uns Friederike Altmanns Arbeiten auch in diesem Heft vorstellt –, eine Antwort „könnte sein, dass es auch Worte, erinnertes Wissen und innere Bilder waren, die dabei halfen“. Friederike Altmann findet dafür vielfältige künstlerische Ausdrucksformen. Ob gemalt, gedruckt, geschrieben, räumlich geformt, klein- und großformatig, auf Farbe und/oder Material konzentriert, alle ihre „Fundstücke“ – Materialcollagen, Vernähungen, Zeichnungen, Mappings, Mindmaps – sind Teil eines über die Jahre immer dichter gearbeiteten erinnerungspolitischen Gewebes, das nie den Unterschied zwischen Imagination und Wahrheit verrät und uns gerade deshalb eine Brücke baut zu einer Erfahrung, die für uns Heutige mit nichts vergleichbar ist und von der Zeugnis abzulegen so unmöglich wie unabdingbar ist.
In der Rubrik Berichte stellen Lisa Schug und Lena Kühn vom FFBIZ, dem feministischen Archiv in Berlin das Vermittlungsprojekt „Bewegtes Berlin – Partizipative Entwicklung digitaler Angebote zu feministischer Geschichte“ vor, das zum Ziel hatte, vielfältige und multiperspektivische digitale Zugänge zur Geschichte der Berliner Frauen- und feministischen Bewegungen zu schaffen. In einem Nachruf erinnert Juliane Jacobi auf eindrückliche Weise an die im Frühjahr dieses Jahres verstorbene feministische Historikerin, Aktivistin und Autorin Irene Stöhr. Tagungsberichte und Rezensionen zu weiteren Themen runden das Heft ab.
Literatur
Arendt, Hannah (1989 [1955]): Menschen in finsteren Zeiten. Herausgegeben von Ursula Ludz, München.
Arendt, Hannah (2002): Denktagebuch, 1950-1973, Zwei Bände. Herausgegeben von Ursula Ludz und Ingeborg Nordmann, München.
Baldwin, James (2022 [1955]): Von einem Sohn dieses Landes, München.
Butler, Judith (1997): Merely Cultural, in: Social Text 52/53, S. 265-277.
Foucault, Michel (2010): Der Mut zur Wahrheit. Die Regierung des Selbst und der anderen II. Vorlesung am Collège de France 1983/84, Berlin.
Guggenheimer, Jacob/ Utta Isop / Doris Leibetseder / Kirstin Mertlitsch, (Hrsg.) (2013): ‚When we were gender…‘ – Geschlechter erinnern und vergessen. Analysen von Geschlecht und Gedächtnis in den Gender Studies, Queer-Theorien und feministischen Politiken. Bielefeld.
Hark, Sabine (2021): Gemeinschaft der Ungewählten. Umrisse eines politischen Ethos der Kohabitation, Berlin.
Haug, Frigga (1990): Erinnerungsarbeit. Hamburg, Berlin.
Stoler, Ann Laura (2016): Duress. Imperial Durabilities in our Times, Durham. S. 122-170.
Strathern, Marilyn (1992): Reproducing the Future, Manchester.
Tokarczuk, Olga (2020): Der liebevolle Erzähler. Vorlesung zur Verleihung des Nobelpreises für Literatur, Zürich.
[1] Ausführlicher auseinandergesetzt mit der Frage, was es bedeutet, in Gegenwart der Wirklichkeit zu leben und schreiben, hat sich Sabine_ Hark in Gemeinschaft der Ungewählten. Umrisse eines politischen Ethos der Kohabitation, Berlin 2021, besonders im Kapitel „In Gegenwart der Wirklichkeit schreiben“, S. 27-35.
[2] Siehe hierzu unter anderem die Beiträge in Guggenheimer, Jacob/ Utta Isop/ Doris Leibetseder/ Kirstin Mertlitsch (Hg.) (2013): ‚When we were gender…‘ – Geschlechter erinnern und vergessen. Analysen von Geschlecht und Gedächtnis in den Gender Studies, Queer-Theorien und feministischen Politiken. Bielefeld. Weitere Literaturhinweise im Beitrag von Thomas und Hipfl sowie im Editorial von Heft 1_23 der Feministischen Studien.
Suche
Seiten
„Sich nicht unterordnen, sich widersetzen, sich empören, sich auflehnen gegen Autoritäten“ – Florence Hervé zum 80. Geburtstag
Florence Hervé wurde am 17. April 1944 in in einem Vorort von Paris geboren. Als eine zentrale Vertreterin der sozialistischen, internationalen und radikaldemokratischen Frauenbewegungen nahm Hervé an zahlreichen UN-Konferenzen und internationalen...
Eine der „originellsten Feministinnen der Zeit“
Der Cross-over-Aktivistin und feurigen Feministin Johanna Elberskirchen (11.4.1864-17.5.1943) zum 160. Geburtstag Christiane Leidinger Die Autorin ist Politik- und Sozialwissenschaftlerin und hat eine Professur an der Hochschule Düsseldorf inne. „Der reine...
Call for Abstracts: Artikulationen von Klasse und Geschlecht
Elisabeth Klaus, Mona Motakef Artikulationen von Klasse sind unüberhörbar geworden. Nachdem Klassenkonzepte lange Zeit als reduktionistisch und unzeitgemäß galten, ist spätestens seit der Finanzkrise 2007/2008 die Analyse von (antagonistischen) Klassen und...